Gespräche
17.07.2025 - 89-Das Gespräch mit Philippa Sigl-Glöckner
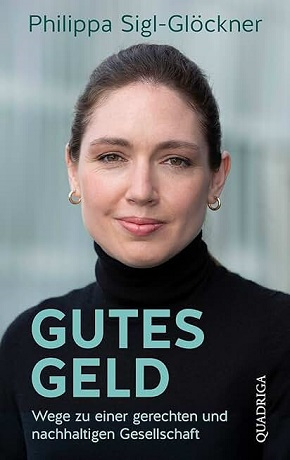
Autorin Phiilippa Sigl-Glöckner
Philippa Sigl-Glöckner ist Ökonomin, Expertin für Finanzpolitik und Geschäftsführerin der Denkfabrik Dezernat Zukunft. Sie hat in Oxford und London studiert und hat bei der Weltbank in Washington D.C. sowie im deutschen und im liberianischen Finanzministerium gearbeitet. Und sie hat das Buch „Gutes Geld - Wege zu einer gerechten und nachhaltigen Gesellschaft“ geschrieben, das im Herbst 2024 im Quadriga Verlag erschienen ist.
Aus dem
Newsletter September 2024 zum Erscheinen Ihres Buches:
Ich habe das Buch „Gutes Geld“ geschrieben, um zu zeigen, dass die Parteien der Mitte das Versprechen von einem selbstbestimmten Leben in Würde einlösen können. Und zwar trotz des Klimawandels, außenpolitischer Herausforderungen und eines Kapitalismus, der weniger stabil ist als gedacht. Es sind nicht äußere Zwänge, sondern unsere Ideen zur Finanzpolitik, die einer besseren Welt im Weg stehen.
Um das freizulegen, nimmt Philippa Sigl-Glöckner uns mit in die Geschichte der deutschen Finanzpolitik. Es geht um zufällige Kennzahlen, sich verselbständigende Formelapparate, Politiktheater und eine Idee, die nie jemand hatte.
Betrachtet man die Geschichte der deutschen Schuldenbremse, wird klar, dass es besser geht. Denn unsere Schuldenregeln sind nicht die wissenschaftlich fundierten Apparate, für die sie gehalten werden. Sie sind eher zufällig zustande gekommen und zwingen die Politik, sich auf kleinteilige Kennzahlen zu fokussieren, statt aktive Strukturpolitik zu betreiben. Die Geldflüsse sind starr geworden, die Politik unbeweglich. Geld dient nicht mehr der Gesellschaft.
Frau Sigl-Glöckner, was muss der Staat tun, damit Geld der Gesellschaft dient?
Ich denke, fundamental den Ansatz, wie man mit Geld umgeht oder über Geld nachdenkt, vom Kopf auf die Füße stellen. Wir fangen heute damit an, Schuldenregeln aufzustellen und Grenzen zu setzen, anstatt zu sagen: wir überlegen, was wir eigentlich als Gesellschaft wollen und wie das Geld uns helfen kann, dahin zu kommen. Man kann ja sagen, eine Sache die wir wollen, ist dass die nächste Generation keine zu hohe Zinslast haben soll, und deswegen begrenzen wir Schulden. Aber man sollte erstmal damit anfangen: Was wollen wir eigentlich? In den letzten dreißig Jahren hat man immer direkt bei den Kennzahlen angefangen. Nicht um sie „runter“ zu deklinieren, sondern erstmal die Frage zu beantworten: Wie begrenzen wir die Schulden, damit es nicht schlimm wird? Wir sollten aber eigentlich fragen: Wie wird es gut?
Ist die Vollbeschäftigung ein wichtiges Ziel?
Das ist das absolut zentrale Ziel. Idealerweise bringen wir dort zusammen, was die meisten Menschen richtig finden und was finanzpolitisch machbar ist. Und die meisten finden richtig, dass sich jeder ein bisschen anstrengen muss, es dann aber auch gut geht für einen. Dass jede oder jeder von der eigenen Arbeit leben kann. Finanzpolitisch ist wichtig, dass der Staat ordentliche Steuereinnahmen hat und nicht immer mehr Geld aufwenden muss, um Individuen zu subventionieren, die zu wenig zum Leben verdienen. Bei Vollbeschäftigung ist beides erfüllt. Der Bundeshaushalt geht gut auf und jede und jeder hat die Chance auf einen Job. Für mich war es sehr schön zu finden, dass das der Schlüssel ist. Wenn wir das erreichen, was wir als Gesellschaft richtig finden, dann funktionieren auch die Finanzen.
Dann haben Sie festgestellt, dass die Schuldenbremse so konstruiert ist, dass sie gerade Vollbeschäftigung verhindert, weil sie sich an den letzten zehn Jahren orientiert, dass sie gerade verhindert, dass mehr Frauen berufstätig werden. Also hat die Schuldenbremse entgegengesetzte Wirkung und vergrößert die Kosten des Sozialsystems. Und auf lange Sicht gesehen bedeutet das, dass gerade Frauen so niedrige Renten haben, dass der Staat nochmal dazu schießen muss.
Da konstruiert man Schuldenregeln, die dem Staat die Hände binden und es unmöglich machen, das Richtige zu tun, und auf der anderen Seite für eine nicht nachhaltige Finanzpolitik sorgen, weil sie die Frauen nicht in Arbeit bringen. Da sieht man den Fehler dieses Ansatzes, dass man nicht vom Ziel her denkt, sondern sagt, wir müssen irgendwo eine Regel einziehen. Dann heißt es, ob die Zahl jetzt genau richtig ist, wissen wir nicht, aber wir mussten doch irgendwo eine Grenze einziehen. Anstatt nachzudenken, wie es gut geht.
Ein Buch über „Gutes Geld“ zu schreiben ist eine Herausforderung, denn welche Rolle spielt das Geld im alltäglichen Leben und für unsere Wirtschaft? Sie haben diese Herausforderung angenommen und Ihr Buch ist auf dem Buchmarkt. Es ist ein gutes Buch. Sehr informativ, ausführliche Erläuterungen, auch für uns Normalbürger verständlich. Sie untersuchen das Thema Rente und erklären uns den Eichhörnchen-Modus des Staates. Sie stellen unkompliziert die Widersprüche der komplexen Finanzpolitik dar, das macht das Buch so lesenswert.
Sie betonen, dass das Geld eine Erfindung des Menschen ist, eine soziale Einrichtung. Ich bin froh, dass der Euroschein einen Wert hat, weil er gesetzliches Zahlungsmittel ist.
Warum ist es für Sie so wichtig, die Widersprüche der Schuldenbremse aufzuzeigen?
Wenn wir verstehen, wo der Fehler in der Politik liegt, können wir sehen, wie es anders gehen könnte. Ich glaube, dass das ein Grund ist für Politikverdruss. Es wird viel versprochen, aber dann nicht umgesetzt. Ich finde es wichtig, einen Ansatzpunkt zu haben, um zu zeigen, wie es besser gehen kann.
Ihr Buch ist ein persönlicher Gang durch die finanzpolitischen Herausforderungen, vor denen unser Land steht. Der Staat muss seine Rolle annehmen, durch langfristig finanzierte Strukturreformen den Weg in die Zukunft zu weisen und die Unsicherheiten zu reduzieren, damit auch die Wirtschaft investieren kann. Sie haben in Ihrem Buch die Widersprüche der deutschen Schuldenbremse enttarnt und den Reformbedarf benannt.
Am 18. März 2025 hat der alte Bundestag – kurz vor der Konstituierung des neuen – mit Zweidrittelmehrheit die Schuldenbremse im Grundgesetz reformiert. Militärausgaben sind jetzt großenteils davon ausgenommen, für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz wird ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro eingerichtet.
Ist Ihre Kritik jetzt berücksichtigt oder sind Sie enttäuscht?
Es war wichtig, dass die Möglichkeit geschaffen wurde, die Investitionen in die Infrastruktur und Verteidigung zu tätigen. Aber ich hätte es sinnvoller gefunden, die Schuldenbremse an sich zu reformieren, als Ausnahmen zu schaffen. Wir haben jetzt einen spektakulären Regelwust. Man sieht an der Finanzpolitik, wie schwer sie sich tut, das umzusetzen. So viele Regeln tragen weder zu einer demokratischeren noch zu einer nachhaltigeren Finanzpolitik bei. Das zeigt sich auch in unserer aktuellen Studie beim Dezernat Zukunft:
Durch die Zinszahlungen, die für Verteidigungsausgaben und Infrastrukturinvestitionen fällig werden, dürfte der Bundeshaushalt über die nächsten Jahre total zuwachsen. Die Regierung ist dann im regulären Finanzrahmen unter der Schuldenbremse nicht mehr handlungsfähig. Jedes Mal, wenn die Regierung Geld braucht, wird sie es nur mit einer Zweidrittelmehrheit in Bundestag und der Länderkammer, dem Bundesrat, bekommen können. Das halte ich für eine sehr gefährliche Situation.
Zu Anfang des Buches erfährt man, dass Sie in Afrika, genauer in Liberia (an der westafrikanischen Atlantikküste) gearbeitet haben. Was hat Sie motiviert, einen Job als Beraterin des Finanzministers in Liberia anzunehmen, in einem Land, das ja nicht gerade am Mittelmeer liegt?
Das war sehr spannend. Teils kam es daher, dass ich die Region aus der Ebola-Krise kannte. Ich arbeitete damals bei er Weltbank in Washington/USA und wurde zur UN nach New York geschickt, um die Geldflüsse zwischen Weltbank und UN zu erleichtern. Die Weltbank unterstützte die Länder bei der Krisenbewältigung, das Geld floss über die UN. Ich wollte im Leben immer etwas tun, das einen Unterschied macht, wo man einen positiven Beitrag leisten kann. Ich habe es als großes Glück empfunden, diesen Job zu bekommen und vor Ort mit meiner Arbeit sinnvoll zur Verbesserung der Lage im Land beizutragen.
Haben Sie dort auch Freunde gefunden?
Ja, aber das war nicht leicht, denn es ist dort ein anderes Leben. Als junge Frau, ich war damals 25 Jahre, ist es noch ein Stück herausfordernder. Wo lernt man Kollegen kennen, wenn man neu ist? Beim Feierabendbier. Nun waren aber fast alle meine Kollegen im Finanzministerium Männer. Wenn man sich als Frau auf ein Bier verabreden wollte, konnte das leicht missverstanden werden. Mir sind trotzdem einige Freundschaften aus der Zeit geblieben, über die ich mich bis heute sehr freue. Die Arbeit unter widrigen Umständen kann sehr zusammenschweißen.
Wieso haben Sie dort angefangen, sich mit den Schuldenquoten der EU-Länder zu befassen?
Ganz am Anfang, als ich dort ankam und gerade mal gucken konnte, wo mein Büro ist, kam der Minister herein, ohne sich lange vorzustellen, und fragte, wie viel Schulden er noch machen kann. Er ließ mir nicht viel Zeit für die Antwort. Also lass ich zuhause schnell in den Lehrbüchern nach und erklärte ihm, dass in Europa eine Schuldenquote von 60 Prozent die Grenze sei und dass er die am besten auch einhalten sollte. Auf Nachfrage konnte ich ihm jedoch nicht beantworten warum. Dazu brauchten wir die Kredite dringend, um Liberia wieder aufzubauen – das Land war vom Bürgerkrieg weitgehend zerstört worden. Das hat bei mir einen längeren Rechercheprozess zur Sinnhaftigkeit der 60 Prozent ausgelöst.
Haben Sie sich bei Ihrem Buch Grenzen gesetzt? Thematik, kritisch sein?
Ich wollte dezidiert über Finanzpolitik schreiben. Mein Ziel war es, einmal von ersten Prinzipien – wie sieht eine menschliche Wirtschaft aus – bis hin zur konkreten Finanzpolitik die argumentative Kette durchzugehen.
Gab es Komplikationen beim Schreiben?
Das ist mein erstes Buch. Das Jonglieren zwischen persönlicher Erzählung und Geschichte musste erst seine Form finden. Das war die eine Herausforderung. Dazu funktioniert mein Kopf eher in Logikbäumen als in auf der Perlenkette aufgezogene Geschichten. Logikbäume können sie aber schlecht auf die Seiten malen. Also mussten die Bäume und ihre Äste zu beschriebenen Seiten werden. Das war schon eine Herausforderung.
Wie war die Zusammenarbeit mit Kollegen bei Ihrem Buch?
Ohne meine Kollegen wäre dieses Buch niemals entstanden. Viel des fachlichen Inputs kommt von ihnen. Deswegen war es mir so wichtig, dass sie namentlich vorkommen.
Haben Sie KI wie etwa ChatGPT zur Recherche verwendet? Oder anders gefragt: hatte KI Einfluss auf Ihr Schreiben?
Ich habe die KI für meine Recherchen genutzt. Für meine Suche nach Dokumenten aus den 1990er Jahren war da einiges zu finden. Das war für mich sehr hilfreich.
Als Co-Vorsitzende des wirtschaftlichen Beirats der SPD sind Sie auch politisch tätig und Sie schreiben Studien. Wie sieht Ihr Alltag aus?
Der wird von meinem Termin-Kalender bestimmt. 80% der Woche sind normalerweise verplant. Sich daran zu halten ist nicht immer einfach, weil ich gerne inhaltlich arbeite oder schreibe. In den letzten drei Monaten haben wir Code geschrieben, um den Bundeshaushalt zu digitalisieren, das kann man nicht immer nach der Stechuhr machen. Dazu fällt es mir nicht immer leicht, alles unter einen Hut zu bringen: Ich bin in München Co-Vorsitzende eines SPD-Ortsvereins, leite das Dezernat Zukunft und bin Präsidentin des European Macro Policy Networks, unter dessen Dach wir in den letzten Jahren Partner-Organisationen im Ausland gegründet haben. Manchmal müsste ich dann eigentlich gleichzeitig in Berlin, Stockholm und der Maxvorstadt sein, aber das geht halt dann nicht.
Sie haben 2018 zusammen mit ein paar Mitstreitern die Denkfabrik
„Dezernat Zukunft - Institut für Makrofinanzen“ gegründet. Mit welchem Ziel?
Konstruktive Vorschläge zur deutschen Finanzpolitik zu machen und diese verständlicher zu erklären. Wenn ich sage konstruktiv, war für uns entscheidend, nicht in Finanzen immer nur das Schlimme zu sehen. Wieso geht es immer nur um den zu verhindernden GAU? Sollten wir nicht ambitionierter sein und die Finanzen so gestalten, dass sie für die Gesellschaft gut sind? Und wir haben uns drei ganz explizit normative Ziele gesetzt: Würde, Wohlstand und Demokratie. Wir glauben, dass diese Werte weitgehend Konsens sind in Deutschland. Dann stellt sich die Frage, wie richtet man die Geldflüsse so aus, dass wir da besser hinkommen. Und wie erklären wir Finanzpolitik so, dass sie möglichst viele verstehen können? Das Verstehen ist ja eine Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie.
Findet die Denkfabrik da Gehör?
Es hat mich sehr überrascht, wie viel Gehör wir finden. Und wie wir von der Politik, von den meisten demokratischen Parteien, positiv aufgenommen wurden. Ich kann nur jeden ermuntern, der sich fachlich in einem Thema gut auskennt, Vorschläge zu machen.
Was macht das Dezernat Zukunft? Wer kann beim Dezernat Zukunft mitarbeiten?
Das Dezernat Zukunft ist als gemeinnütziger Verein organisiert. Finanziert werden wir von Stiftungen. Das ist entscheidend. Denn so können wir wirklich frei denken und bei den Studien kommt oft anderes heraus als anfangs gedacht.
Wir haben glaube ich mittlerweile einen recht guten Ruf an Universitäten. Daher bekommen wir viele Bewerbungen von exzellenten jungen Ökonominnen und Ökonomen, die die Welt ein kleines Stück besser machen wollen und bereit sind, dafür hart zu arbeiten. Dass sich junge Kollegen nur für ihre Work-Life-Balance interessieren, kann ich nicht bestätigen. Wir erfahren das Gegenteil, die jungen Leute suchen sehr nach einem Ansatzpunkt, wo sie etwas sinnstiftendes beitragen können.
Was bleibt Ihnen nach dem Schreiben von „Gutes Geld“? Schreiben Sie ein weiteres Buch? Es ist wichtig, Volkswirtschaft verständlich und spannend vermittelt zu bekommen, so wie in und mit Ihrem Buch.
Ich bin erstmal sehr froh, dieses Buch über die Ziellinie gebracht zu haben. Aber ein kleines bisschen juckt es mich in den Fingern: das Thema materielle Gleichstellung hätte eine ernsthafte finanzpolitische Betrachtung verdient ….
Vielen Dank für das Gespräch.
©Steffi.M. Black (Text)
©Quadriga Verlag Annette Hauschild/Ostkreuz (Bild)